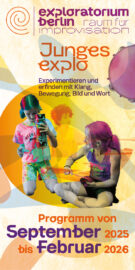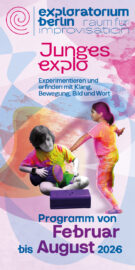„Der blinde Fleck, das Unverfügbare, das, was nicht da ist, aber trotzdem da ist – das fasziniert mich sehr. Es ist wie in einer guten Improvisation: Man verfügt nicht darüber, sondern sie kann entstehen. Das kann man nur üben, indem man versucht, sich in eine offene Haltung der Resonanzbeziehung zu begeben. Es ist immer dieses Ringen um das, was noch nicht da ist, was nicht selbstverständlich ist, was man nicht beherrschen und schon gar nicht besitzen kann. Das ist etwas, was mich unglaublich fasziniert.“ (Charlotte Hug)
„Im Zentrum der Berichte improvisierender Musiker zur Interaktion im Ensemble steht eine spezifische Erfahrung: das Zuhören, Sich-Zurücknehmen, den anderen Musikern und der Musik Raum-Geben. Diese Spielhaltung des ›Hörens und Antwortens‹, mithin der dispositionalen Resonanz, ist Voraussetzung dafür, dass die Musik das Regime übernimmt und eine Art Magie entsteht […].“ (Martin Pfleiderer & Hartmut Rosa)
Improvisation lebt vom Moment, von Aufmerksamkeit, Bewegung und Begegnung. Resonanz – als Widerhall, Mitschwingen, Antwort – erscheint dabei nicht nur als mögliches Resultat, sondern vielleicht sogar als innere Bedingung improvisierenden Handelns. Das 11. vom exploratorium berlin ausgerichtete Symposium lädt dazu ein, Improvisation als Resonanzgeschehen zu denken – ästhetisch und performativ, sozial und epistemisch, klanglich und körperlich. Im Zentrum steht die Auseinandersetzung mit freier, experimenteller Improvisation in der Musik, jedoch sollen auch Bezüge zu anderen avancierten Kunstformen hergestellt werden.
Vier Leitfragen strukturieren das Symposium und dienen als Ausgangspunkt für den gemeinsamen Diskurs: Was bedeutet Resonanz im Kontext von Improvisation? Kann Resonanz als eine spezifische Qualität in Improvisationsprozessen verstanden werden? Wie wird Resonanz in improvisierten Prozessen erfahrbar – zwischen Menschen, Räumen, Klängen, Zeiten? Und wie lässt sich das Momenthafte, Situative, das auf Antwort und Widerhall gerichtete Handeln der Improvisation über den Begriff der Resonanz analytisch fassen?
Aus der Akustik stammend, vermag der Resonanzbegriff vielfältige Assoziationsräume zu eröffnen. Seine metaphorische wie analytische Reichweite macht ihn anschlussfähig für künstlerische Praktiken, musikphilosophische Überlegungen und sozialwissenschaftliche Theoriebildung. Besonders in der von der Kritischen Theorie beeinflussten Soziologie Hartmut Rosas hat der Begriff eine bemerkenswerte Karriere gemacht. Dort beschreibt er Resonanz als eine grundlegende Form der Weltbeziehung – ein Konzept, das sich produktiv auf improvisatorische Prozesse übertragen lässt.
Resonanz kann dabei nicht nur als Ziel, sondern auch als Erkenntnismoment verstanden werden: In der Charakteristik von Resonanz – etwa als affektive Rückkopplung, als Transformation durch Berührung und Antwort – offenbart sich das Wesen improvisatorischen Handelns. Als dezidiert relationaler Begriff erlaubt Resonanz die Analyse vielfältiger rekursiver und interdependenter Wirkungsprinzipien: die Interaktion der Spielenden, das Phänomen des Hörens und Zuhörens, das Erspüren der Schwingungen musikalischer Eigenfrequenzen instrumentaler Klangkörper, das intuitive Verstehen der Affordanzen von Räumen, Atmosphären und Publikum, letztlich aller beteiligten Aktanten. Resonanzphänomene können als Motor innerhalb emergenter Improvisationsprozesse eine entscheidende Rolle spielen. Die in Improvisationen zwischen Aktanten wirksame autopoietische Feedback-Schleife kann als zirkulierende Energie begriffen werden, wie Rosa sie in Resonanzbeziehungen ausmacht.
Nach Rosa lassen sich vier zentrale Voraussetzungen für Resonanzbeziehungen benennen: Affizierung, Selbstwirksamkeit, Transformation und Unverfügbarkeit. Diese vier Merkmale scheinen auch für improvisatorische Prozesse grundlegend: Sie erfordern Offenheit für Impulse, tätiges Antworten, die Bereitschaft zur Veränderung und das Akzeptieren des Unverfügbaren. Dem Begriff der Unverfügbarkeit widmet Rosa dabei besondere Aufmerksamkeit; diesem Aspekt von Unplanbarkeit und Unkontrollierbarkeit möchte sich das Symposium, bezogen auf Improvisation, ebenfalls widmen. Auch soll Rosas Konzept der Mediopassivität, dem Dazwischen von Aktivität und Passivität, das sich ebenfalls als bedeutsam für improvisatorisches Handeln erweist, hervorgehobene Aufmerksamkeit geschenkt werden.
Beiträge:
Christoph Baumann: Resonanz-gemeinsamer musikalischer Raum – Hyperinstrument
Ulrike Brand: BODY_CELLO_MASS
Corinna Eikmeier: Unverfügbarkeit
Silvana Figueroa-Dreher: Improvisieren durch Modi der Resonanz
Jonas Gerigk: „In Resonanz“ – Kirchenkonzerte mit dem Trio vließ
Christian Grüny: Resonanz, Responsivität, Hören: Zwischen Begriff und Metapher
Stephanie Hanna: Körper Spüren: Resonanzen und kollektives Bewusstsein
Diego Kohn: Plastische Resonanz: Improvisation zwischen Form, Wandel und Offenheit
Ivar Roban Križić: ESP Duos: Imaginierte Ko-Präsenz und die resonanten Spuren der Zusammenarbeit
Thomas Lange: Resonanzlehre und freie, musikalische Improvisation (Vortrag) + Improvisation Resonanz Improvisation. Die (Wieder-)Entdeckung radikaler Schönheiten in der freien, musikalischen Improvisation (Workshop)
Susanne Martin & Katarzyna Brzezinska: Das tänzerische Mediopassiv – Berührung in der Contact Improvisation
Sarah Maupeu & Johanna Seiler: Die Widmungsabsicht als Weg zu Resonanzerleben. Das HeilSang-Format von Johanna Seiler zwischen freier Vokalimprovisation und transformativer Erfahrung.
Jürgen Oberschmidt: Musik lernen: Von der Planbarkeit durchwaltet oder in die Freiheit entlassen?
Anna Pietsch: Improvisation und Resonanz: Anatomie einer Begegnung (Vortrag & Atelier)
Martin Pfleiderer & Hartmut Rosa: Improvisation und Resonanz
Jakob Ruster: Resonanz in der Improvisation – von Geburt an? Die Theorie der Communicative Musicality von Colwyn Trevarthen und Stephen Malloch und kindlich-spielerische Resonanzerfahrung
Christopher Salzbrunn: Unreproduzierbare Musik – Die Reformation der Postmoderne in der improvisierten Literatur
Wolfgang Schliemann: „Beim Hören bin ich auf der Schwelle.“
Sue Schlotte: „Sowohl als auch: Gleichzeitige Wahrnehmung als Schlüssel für gelungene freie Improvisation!“ – ein praktischer Vortrag
Eric Thielemans: Resonant Scores: Exploring Resonance Through Emergent Music Practice. A practical exploration of resonance within and through musical performance
Dietmar Jürgen Wetzel: Stimme, Resonanz und Humor – kulturelle Praktiken vokaler Improvisation
Symposiums-Eröffnung am Freitag, den 30. Januar 2026, 20:00 Uhr:
Sound & Lecture N° 27: Charlotte Hug / Lê Quan Ninh – Resonances
Den Auftakt zu dem Symposium, am 30. Januar 2026 um 20:00 Uhr, bildet als 27. Ausgabe der Sound & Lecture-Reihe des exploratorium eine Performance der Bratschistin, Vokalistin und Trägerin des Schweizer Musikpreis 2025 Charlotte Hug gemeinsam mit dem Perkussionisten Lê Quan Ninh. Aus der Beschäftigung mit Hartmut Rosas Resonanz-Begriff bezog Charlotte Hug wesentliche Inspiration für ihre künstlerische Arbeit; für Lê Quan Ninh ist die Interaktion mit den resonanten Qualitäten seines Instrumentariums von zentraler Bedeutung. Hierüber geben sie im Künstler*innen-Gespräch mit Mathias Maschat Auskunft.
Abend-Programm am Samstag, den 31. Januar 2026, 20:00 Uhr:
Recovered Resonances: Sofia Borges & Brad Henkel
Das Projekt Recovered Resonances der Perkussionistin Sofia Borges und des Trompeters Brad Henkel erforscht den tiefgreifenden Akt der Klang-Reklamation: das Einfangen verblassender Resonanz, ihre aktive Rückgewinnung und Neuformung zu neuem Leben. Sein Kern ist Meta-Resonanz – die bewusste Wiederaufnahme und Transformation akustischer Energie und ihrer physischen Quelle.
DOWNLOAD CALL FOR PAPERS SYMPOSIUM: IMPROVISATION UND RESONANZ
Nachfolgende Veranstaltungen finden im Konzertsaal statt; eine Auswahl (!) davon wird per Livestream übertragen und steht auch anschließend auf unserem YouTube-Kanal zur Verfügung.
Samstag, 31.01.: (keine Anmeldung mehr möglich!)
10:00-10:15 Mathias Maschat: Begrüßung
10:15-11:40 Martin Pfleiderer & Hartmut Rosa: Improvisation und Resonanz
12:15-12:40 Ulrike Brand: BODY_CELLO_MASS
12:45-13:10 Silvana Figueroa-Dreher: Improvisieren durch Modi der Resonanz
14:45-15:25 Christian Grüny: Resonanz, Responsivität, Hören: Zwischen Begriff und Metapher
15:30-15:55 Corinna Eikmeier: Unverfügbarkeit
16:30-16:55 Jürgen Oberschmidt: Musik lernen: Von der Planbarkeit durchwaltet oder in die Freiheitentlassen?
17:00-17:40 Dietmar Jürgen Wetzel: Stimme, Resonanz und Humor – kulturelle Praktiken vokaler Improvisation
17:45-18:10 Diego Kohn: Plastische Resonanz: Improvisation zwischen Form, Wandel und Offenheit
Sonntag, 01.02.: (keine Anmeldung mehr möglich!)
10:30-11:25 Thomas Lange: Resonanzlehre und freie, musikalische Improvisation
12:00-12:25 Sue Schlotte: Sowohl als auch: Gleichzeitige Wahrnehmung als Schlüssel für gelungene freie Improvisation
12:30-12:55 Wolfgang Schliemann: „Beim Hören bin ich auf der Schwelle.“
13:45-14:10 Christoph Baumann: Resonanz-gemeinsamer musikalischer Raum – Hyperinstrument
14:15-14:40 Ivar Roban Križić: ESP Duos: Imaginierte Ko-Präsenz und die resonanten Spuren der Zusammenarbeit
14:45-15:25 Christopher Salzbrunn: Unreproduzierbare Musik – Die Reformation der Postmoderne in der improvisierten Literatur
15:30-16:10 Jonas Gerigk: „In Resonanz“ – Kirchenkonzerte mit dem Trio vließ